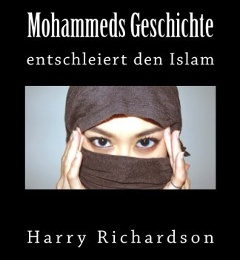| Datei: | vds.php |
| Erstellt: | 05.03.2010 |
| Aktualisiert: | 05.03.2010 |
Ein schwarzer Tag für Deutschland
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung

Es ist Dienstag, der 02.03.2010, 10 Uhr vormittags. Das Fernsehen überträgt das lang erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Vorratsdatenspeicherung (VDS). Die gesetzlichen Regelungen der VDS sehen vor, daß sämtliche Telekommunikations- Verbindungsdaten aller Bürger ohne jeden Verdacht für sechs Monate auf Vorrat gespeichert werden, um mittels Telekommunikation begangene Straftaten auch Monate später noch aufklären zu können. Gespeichert werden nach diesem Gesetz wer mit wem telefoniert und wie lange das Gespräch dauert. Auch der Ort, an dem sich die Kommunizierenden aufhalten, wird präsize gespeichert. Im Internet wird aufgezeichnet, wer welche IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt benutzt. Bei Kommunikation mittels E-Mail wird gespeichert, wer wem wann und von wo aus eine E-Mail schickt. Außerdem wird die Betreffzeile der Mail gespeichert. Gegen diese verdachtslose Überwachung haben unter anderem rund 34.000 Bürger geklagt.
Die ersten Worte von Hans-Jürgen Papier lassen noch hoffen, denn mehrmals wird verkündet, daß diese und jene Regelungen des Telekommunikationsgesetzes nichtig sind. Doch schon wenige Sätze später schlägt die Freude in eine tiefe Bestürzung um, denn es wird klar, daß mit diesem Urteil ein wichtiges Grundrecht, welches einst von ebendiesem Gericht in richterlicher Rechtsfortbildung erschaffen wurde, nun wieder zu großen Teilen zu Grabe getragen wird. Die Rede ist vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Rückblende: Am 15.12.1983 sprach das BVerfG das sogenannte Volkszählungsurteil. Im Rahmen dieses Urteils kritisierte das Gericht das überhand nehmende Informationsbegehren des Staates über seine Bürger und stellte das Recht auf informationelle Selbstbestimmung heraus, welches als weitere Ausprägung den allgemeinen Persönlichkeitsrechten hinzugefügt wurde. Die informationelle Selbstbestimmung entstand so durch richterliche Rechtsfortbildung aus den Artikeln 1 (1) GG (Menschenwürde) und 2 (2) GG (allgemeine Handlungsfreiheit) des Grundgesetzes.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, nachfolgend kurz ISB genannt besagt, daß jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber entscheiden darf, ob und wem er seine personenbezogenen Daten zu welchem Zweck preisgibt. Mit der Entwicklung des Rechts auf ISB stellte das BVerfG klar, daß personenbezogene Daten kein frei zugängliches Informationsmaterial sind und der Zugriff eine begründungsbedürftige Ausnahme ist.
Seit damals hat das BVefG in allen seinen Urteilen dieses Grundrecht geschützt und gestärkt. So zum Beispiel am 14.07.1999 im Urteil 1 BvR 2226/94. Zitate aus diesem Urteil:
- In der Abschirmung des Kommunikationsinhalts gegen staatliche Kenntnisnahme erschöpft sich der Grundrechtsschutz jedoch nicht. Er umfaßt ebenso die Kommunikationsumstände. Dazu gehört insbesondere, ob, wann und wie oft zwischen welchen Personen oder Fernmeldeanschlüssen Fernmeldeverkehr stattgefunden hat oder versucht worden ist.
- Mit der grundrechtlichen Verbürgung der Unverletzlichkeit des Fernmeldegeheimnisses soll vermieden werden, daß der Meinungs- und Informationsaustausch mittels Fernmeldeanlagen deswegen unterbleibt oder nach Form und Inhalt verändert verläuft, weil die Beteiligten damit rechnen müssen, daß staatliche Stellen sich in die Kommunikation einschalten und Kenntnisse über die Kommunikationsbeziehungen oder Kommunikationsinhalte gewinnen.
- Insoweit lassen sich die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat, weitgehend auf die speziellere Garantie in Art. 10 GG übertragen.
- Eine Sammlung nicht anonymisierter Daten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken wäre damit unvereinbar.
In einem anderen Urteil vom 12.03.2003 mit dem Aktenzeichen 1 BvR 330/96 meinte das BVerfG:
- Das Fernmeldegeheimnis schützt zwar in erster Linie den Kommunikationsinhalt, umfasst aber ebenso die Kommunikationsumstände. Dazu gehört insbesondere, ob, wann und wie oft zwischen welchen Personen oder Endeinrichtungen Telekommunikationsverkehr stattgefunden hat oder versucht worden ist.
- Das Gewicht des Strafverfolgungsinteresses ist insbesondere von der Schwere und der Bedeutung der aufzuklärenden Straftat abhängig. Insofern genügt es verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht, dass die Erfassung der Verbindungsdaten allgemein der Strafverfolgung dient. Vorausgesetzt sind vielmehr eine Straftat von erheblicher Bedeutung, ein konkreter Tatverdacht und eine hinreichend sichere Tatsachenbasis für die Annahme, dass der durch die Anordnung Betroffene als Nachrichtenmittler tätig wird.
- Voraussetzung der Erhebung von Verbindungsdaten ist ein konkreter Tatverdacht. Auf Grund bestimmter Tatsachen muss anzunehmen sein, dass der Beschuldigte mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen hat.
Mit dem Urteil vom 02.03.2010 zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet sich das BVerfG von diesen hohen Maßstäben. Sofern das Gericht nicht selbst den Widerspruch zu früheren Urteilen, insbesondere zu dem zuletzt genannten Zitat sieht, wonach die Erhebung der Daten nur bei konkretem Tatverdacht erfolgen darf, dann wohl nur deshalb, weil es die Erhebung nur dann als Erhebung betrachtet, wenn sie durch den Staat selbst erfolgt, nicht aber wenn sie im Auftrag des Staates erfolgt. Wäre das die Sichtweise des Gerichts, dann dürfte ich das mit Fug und Recht als Spitzfindigkeit bezeichnen.
Hans-Jürgen Papier verkündete am 02.03.2010 im Namen des Volkes, daß eine sechsmonatige, vorsorglich anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten durch private Diensteanbieter, wie sie die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 vorsieht, mit Art. 10 GG nicht schlechthin unvereinbar sei.
Mit anderen Worten hält das BVerfG nun im krassen Widerspruch zu früheren Urteilen eine Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich für Verfassungskonform. Ein schwarzer Tag für Deutschland, für unsere freiheitliche Grundordnung und für die Grundrechte aller Bürger.
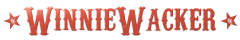
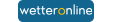

 Android-Handy
Android-Handy